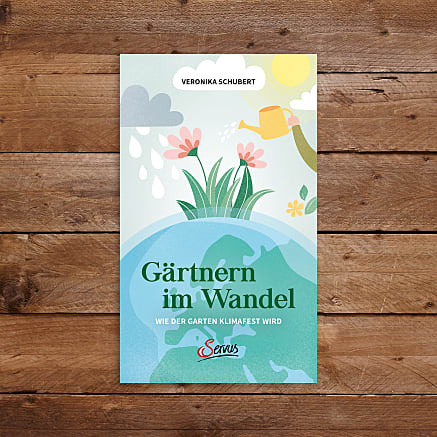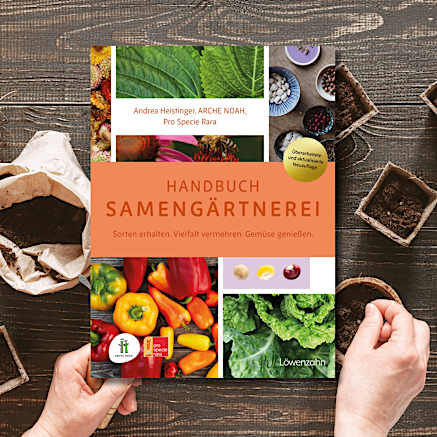8 fast vergessene Nutzpflanzen für den Garten
Inhalt
- Alte Gemüsesorten sind samenfest
- Rapunzel-Glockenblume (campanula rapunculus)
- Stangenbohne Posthörnchen (phaseolus vulgaris var. vulgaris)
- Haferwurzel (tragopogon porrifolius)
- Erdmandel (cyperus esculentus)
- Küchenzwiebel „Rote Wiener“ (allium cepa)
- Eiskraut (mesembryanthemum crystallinum)
- Zuckerwurzel (sium sisarum)
- Einlege- und Salatgurke „Dekan“ (cucumis sativus)
Alte Gemüsesorten sind samenfest
Die bunte Vielfalt in den Obst- und Gemüseabteilungen des Lebensmittelhandels täuscht: Es gibt zwar viel Exotisches – doch die Verarmung von Kultursorten in unseren Breiten nimmt ungebremst ihren Lauf. „Wir kennen eine grüne, lange und kerzengerade Frucht und nennen sie Gurke, aber das war’s dann schon“, meint Gebhard Kofler-Hofer, Gartenleiter in Schiltern. „Tatsächlich gibt es Dutzende verschiedene Arten: Schlangengurken, Wachsgurken, Schwammgurken, Scheibengurken. Gurken sind eine große Familie.“
Seit mehr als 20 Jahren setzt sich die Arche Noah für Sorten ein, die vor Generationen noch naturnah angebaut wurden, dann aber verschwanden, weil in der Landwirtschaft Ertrag vor Qualität gereiht wurde und Gleichförmigkeit vor Formenvielfalt.
Uns ist wichtig, dass Saatgut im Kreislauf bleibt.Gebhard Kofler-Hofer, Arche-Noah-Schaugarten in Schiltern
Alte und regionale Gemüsesorten haben einen großen Vorteil: Sie sind nicht nur optimal an die lokalen Klimaverhältnisse und Böden angepasst. Man kann sie auch weitervermehren, denn sie sind „samenfest“.
Sogenanntes F1-Saatgut dagegen muss man jedes Jahr neu kaufen. Zwar könnte man auch von den daraus gezogenen Hybriden Samen ernten. Deren Nachkommen behielten jedoch die Eigenschaften der Elternpflanzen nicht einheitlich bei.
„Uns ist wichtig, dass Saatgut im Kreislauf bleibt“, erklärt Gebhard Kofler-Hofer. ,,Am besten nicht bei uns, sondern dort, wo es hingehört – bei den Landwirten und Hobbygärtnern, die mit uns zusammenarbeiten. Ob diese Pflanzen durchwegs heimisch sind, ist dabei gar nicht so wichtig.“
Pflanzensamen aus aller Welt
Denn Pflanzen sind immer schon um die Welt gereist, wurden in andere Länder mitgenommen und dort angebaut. Das Eiskraut etwa, ein unscheinbares Pflänzchen mit säuerlichem Geschmack, ist heute für uns so neu wie es der Paradeiser unseren Ahnen am Ende des Mittelalters war. Als Salat und dekoratives Kräutlein hat es aber Potenzial. Wie auch der Malabarspinat, dessen runde, fleischige Blätter sich für Salate und Spinatgemüse eignen und wie junge Maiskolben schmecken. Beide Arten sind gleichzeitig auch hübsche Zierpflanzen mit rosa Blüten.
Die Wurzelknollen der Yacón erntet man dagegen erst nach dem ersten Frost. In den Anden werden sie seit Jahrhunderten als Salat oder Gemüse zubereitet. Der aromatisch süße Geschmack ist mit einer Honigmelone oder Birne vergleichbar.
Man muss all diese weit gereisten Nutzpflanzen nur immer wieder anbauen und sie durch Samengewinnung am Leben erhalten – dann haben sie auch in unseren Beeten eine glorreiche Zukunft.
Rapunzel-Glockenblume (campanula rapunculus)
Die Wurzeln der heimischen Rapunzel-Glockenblume wurden früher als Wintersalat genossen. Im 16. Jahrhundert wurde sie auch in den Gärten gezogen, im 19. Jahrhundert nahm der Anbau wieder ab. Heute ist die Wildpflanze vom Aussterben bedroht und darf nicht mehr gesammelt werden.
Kultur: Ende Mai aussäen; die jungen Pflänzchen dürfen nicht zu eng stehen, damit sie große Wurzeln bilden. Die Blätter können zwischendurch geerntet werden, die Wurzeln ab Oktober und den ganzen Winter über.
Standort und Pflege: locker-humoser, nährstoffreicher Boden. Im ersten Jahr wird eine Blattrosette gebildet, im zweiten ein Stängel mit violetten Blüten.
Verwendung: Die fingerdicken, fleischigen Wurzeln kann man roh und in Scheibchen geschnitten in den Salat geben, die Blätter werden wie Feldsalat zubereitet.

Stangenbohne Posthörnchen (phaseolus vulgaris var. vulgaris)
Das Posthörnchen ist eine Spezialität aus dem südsteirischen Raum. Die gelben, fadenlosen Fisolen sind kipferlförmig gebogen, die Bohnen schwarz-violett gesprenkelt.
Kultur: Direktsaat ab Anfang Mai bis Ende Juni (Saattiefe: 3 cm). Vorkultur in Töpfen möglich, pikieren ist nicht nötig. Vor dem Legen der Samen eine Kletterhilfe aus Stangen errichten. Reifezeit: ab August.
Standort und Pflege: tiefgründiger, humusreicher Boden und sonniger, windgeschützter Standort. Düngen mit Kompost und organischem Dünger, der nur wenig Stickstoff enthält (z.B. Holzasche, Knochenmehl).
Verwendung: Die Fisolen werden als Salat oder Gemüse zubereitet und schmecken sehr gut.

Haferwurzel (tragopogon porrifolius)
In Südeuropa und Nordafrika seit der Antike bekannt, später aber von der Schwarzwurzel verdrängt.
Kultur: Zweijährig, im April direkt ins Beet säen; Abstand zwischen den Reihen: 30 cm, Abstand in der Reihe: 10 cm. Gleichmäßig feucht halten, damit sich die Pfahlwurzel gut ausbildet. Die Wurzeln können ab Oktober den ganzen Winter über geerntet werden. Im ersten Jahr schmecken sie feiner. Ohne Ernte kommt es im zweiten Jahr zu rosalila Blüten und anbaufähigen Samen.
Standort und Pflege: im lockeren, durchlässigen Boden wachsen die Pfahlwurzeln tiefer und gerader; Boden eventuell mit Sand verbessern.
Verwendung: Wie Schwarzwurzeln zubereiten, nussig, herber Geschmack; junge Blätter als Salat; wegen des enthaltenen Inulins besonders für Diabetiker geeignet.

Erdmandel (cyperus esculentus)
Die Erdmandel wurde schon in der Jungsteinzeit als Nahrungspflanze verwendet. Die ältesten Funde stammen aus ägyptischen Gräbern (2000 v. Chr.).
Kultur: Im Mai 5–6 Knöllchen (zwei Tage im Was ser vorquellen) horstartig auspflanzen, im Abstand von etwa 40 cm und 3 cm tief. Nach dem ersten Frost mit der Grabgabel aus der Erde heben und die Erdmandeln ernten.
Standort und Pflege: humose, sandige, steinfreie Böden oder im Topf kultivieren; während des Sommers reichlich gießen.
Verwendung: Die Knöllchen haben ein mandelartiges Aroma und sind roh oder gekocht essbar; geröstet als Knabberei oder zur Gewinnung von Speiseöl. In der spanischen Region um Valencia bereitet man daraus ein milchartiges Erfrischungsgetränk, die „Horchata“, zu.

Küchenzwiebel „Rote Wiener“ (allium cepa)
Diese Sommerzwiebelsorte ist dunkelrot, flachrund, robust und im Keller gut lagerfähig.
Kultur: Zur Vorkultur auf dem Fensterbrett ab Mitte Februar bis April flach in Saatschalen aussäen, später pikieren – oder ab März bis April Direktsaat ins Beet.
Standort und Pflege: sonniger Standort auf leichten, gut durchlüfteten Böden; nach der Ernte vor dem Einlagern auf dem Beet abtrocknen lassen.
Verwendung: Milder Geschmack; die schöne rote Farbe ist eine optische Bereicherung in der Küche, z. B. für Erdäpfelsalat oder Aufstriche.

Eiskraut (mesembryanthemum crystallinum)
Das im Mittelmeerraum und an den Küsten Südafrikas heimische Eiskraut wurde früher als Salat und zur Sodagewinnung genutzt. In Frankreich bereitet man heute noch Salat daraus zu.
Kultur: Nicht winterhart; im Topf oder im Beet; am besten ab März drinnen vorziehen und nach Mitte Mai auspflanzen (Reihenabstand 20 cm, Pflanzabstand 30 cm). Lässt man die Pflanzen ausblühen, kann man selbst Samen ernten.
Standort und Pflege: volle Sonne; warmer, durchlässiger Boden (Sand beimischen), braucht trockenes Erdreich, nur wenig gießen, im Haus überwintern.
Verwendung: Die dickfleischigen Blätter einzeln oder die ganzen Triebspitzen als Salat verwenden; säuerlichsalziger Geschmack, sehr erfrischend.

Zuckerwurzel (sium sisarum)
Vermutlich aus Südrussland stammend, war die Zuckerwurzel vor der Verbreitung von Kartoffel und Zuckerrübe eines der beliebtesten Wurzelgemüse Europas. Im Mittelalter wurde ihr aromatisch-süßer Geschmack in höchsten Tönen gelobt.
Kultur: Winterhart; bildet im ersten Jahr eine Blattrosette und im zweiten weiße Blütendolden; unterirdisch ein Bündel fingerdicker Wurzeln. Aussaat erfolgt im Frühjahr in Reihen mit 40 cm Abstand. Ab dem Spätherbst und den ganzen Winter über kann geerntet werden.
Standort und Pflege: nährstoffreiche Böden; benötigt im Sommer viel Feuchtigkeit.
Verwendung: Wurzeln sind roh oder gekocht genießbar, schmecken süßer als Karotten. Zubereitung ähnlich wie Pastinaken: blanchiert für Gemüsegerichte oder püriert für Suppen.

Einlege- und Salatgurke „Dekan“ (cucumis sativus)
Walzenförmige Gurke für das Freiland: bis zu 17 cm lang, mit hellgrün-weiß gestreifter Schale. Die Sorte stammt von der Krim und wird in Österreich schon lange angebaut. Sie ist gut resistent gegen Mehltau.
Kultur: Für die Vorkultur in Töpfen ab Ende April aussäen, nicht pikieren (empfindliche Wurzeln!) und ab Mitte Mai auspflanzen; Direktsaat ab Mitte Mai. Ein Rankgerüst in A-Form ist ideal. Für ausreichende Befruchtung und guten Ertrag sind mindestens zwei Pflanzen notwendig. Gleichmäßig feucht halten.
Standort und Pflege: sehr wärmebedürftig; sonniger und windgeschützter Standort, warme, lockere Böden.
Verwendung: Die wohlschmeckende Sorte eignet sich zum Einlegen, als Rohkost und für Salate.

Das könnte Sie auch interessieren:
15x nach Hause bekommen & nur 12x bezahlen
Wunsch-Startdatum wählen & kostenlos nach Hause liefern lassen
Mindestlaufzeit: 12 Ausgaben, Erscheinungsweise: 12x im Jahr
Jederzeit mit 4-wöchiger Frist zum Monatsende schriftlich kündbar (nach Mindestlaufzeit).